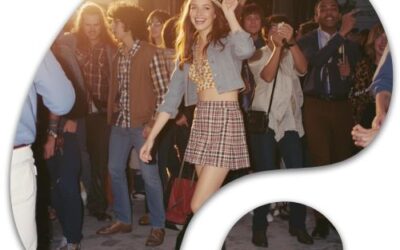Wenn Routine zur Abhängigkeit wird
Die tägliche Tablette gegen Schmerzen, Schlaflosigkeit oder Nervosität gehört für viele ältere Menschen einfach „dazu“. Oft beginnt es harmlos – eine Tablette am Abend, vom Arzt verschrieben, gut gemeint. Doch was als Hilfe startet, kann sich leise zur Abhängigkeit entwickeln.
Rund 1,5 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland gelten laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als medikamentenabhängig – die meisten davon sind ältere Frauen. Und das Tragische: Die Betroffenen selbst merken es oft nicht.
Was im Körper passiert
Beruhigungs-, Schlaf- und Schmerzmittel verändern langfristig die Reizweiterleitung im Gehirn. Das bedeutet: Der Körper „lernt“, dass er ohne das Medikament kaum noch zur Ruhe kommt. Wird die Tablette weggelassen, entstehen Unruhe, Schlafstörungen oder Angst – der Griff zur nächsten Dosis scheint unausweichlich.
Manche Mittel – etwa Benzodiazepine, Z-Substanzen oder starke Schmerzmittel (Opioide) – sind besonders tückisch, weil sie das Wohlgefühl im Moment fördern, langfristig aber die Selbstregulation hemmen.
Woran erkennt man eine mögliche Abhängigkeit?
Betreuungskräfte sind oft die Ersten, die Veränderungen bemerken. Typische Signale sind:
- zunehmende Schläfrigkeit oder Benommenheit,
- Verwirrtheit oder Gedächtnislücken,
- Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit,
- heimliches Horten oder Nachfragen nach Medikamenten,
- Verweigerung von Aktivitäten („Ich bin zu müde“ oder: ich brauch’ erst meine Tablette.“).
Solche Beobachtungen sind keine Anklage, sondern ein Hinweis auf Handlungsbedarf. Wichtig ist, aufmerksam zu bleiben – ohne zu urteilen.
Wie Sie als Betreuungskraft sensibel damit umgehen können
Der wichtigste Satz lautet: Mit Verständnis statt mit Vorwürfen.
- Gespräch öffnen:
„Mir fällt auf, dass Sie in letzter Zeit oft müde sind – möchten wir mal schauen, woran das liegen könnte?“ - Beobachtungen dokumentieren:
z. B. Schläfrigkeit, Stimmung, Vergesslichkeit – als Grundlage für Fachkräfte oder Angehörige. - Kooperation suchen:
Pflegefachkräfte oder ärztlichen Rat hinzuziehen – Betreuungskräfte selbst dürfen keine Medikamente anpassen oder absetzen. - Unterstützung anbieten:
Ablenkung, kleine Spaziergänge, Gespräche oder Entspannungstechniken können helfen, den Fokus vom „Pillenreflex“ zu lösen.
Vertrauen entsteht, wenn Betroffene merken: „Da sieht mich jemand – nicht meine Tablettenschachtel.“
Einen Fuß vor den anderen: In kleinen Schritten aus der Abhängigkeit
Der Ausstieg aus einer Medikamentenabhängigkeit ist kein Sprint. Er braucht ärztliche Begleitung, Geduld und alternative Strategien. Betreuungskräfte können diesen Prozess positiv unterstützen, indem sie:
- auf regelmäßige Tagesstrukturen achten,
- alternative Rituale zur Entspannung fördern (z. B. Atemübungen, Musik, Wärme, Gespräche),
- Erfolgserlebnisse betonen („Sie haben heute auf Ihre Mittags-Tablette verzichtet – großartig!“),
- soziale Kontakte aktivieren – denn Einsamkeit ist oft der Nährboden für Medikamentenkonsum.
Unser Fazit
Medikamentenabhängigkeit ist keine Schwäche, sondern oft das Ergebnis von Gewohnheit, Einsamkeit und Unwissenheit.
Betreuungskräfte können hier entscheidend zur Aufklärung, Entlastung und Menschlichkeit beitragen – durch Beobachtung, ehrliche Gespräche und kleine, alltagstaugliche Schritte.
„Manchmal ist das beste Medikament kein Rezept – sondern jemand, der zuhört.“
Medikamentenabhängigkeit ist nicht die einzige Form von Sucht, die im Alltag der ambulanten Betreuung eine Rolle spielen kann. Suchtverhalten hat viele Gesichter – ob Spielsucht, Esssucht, Alkoholkonsum oder andere Formen, die sich oft langsam in den Alltag einschleichen.Wir freuen uns daher sehr, im 4. Quartal 2026 einen zweistündigen Fachvortrag mit anschließender Diskussionsrunde zu diesem spannenden und sensiblen Thema anbieten zu können. Der genaue Termin wird rechtzeitig auf unserer Webseite sowie im Newsletter bekannt gegeben.
Gemeinsam möchten wir einen offenen Blick auf das Thema „Sucht im Alter und in der Betreuung“ werfen – mit Fachwissen, praktischen Impulsen und der Einladung zum Austausch darüber, wie wir betroffene Menschen professionell, empathisch und ohne Vorurteile begleiten können.